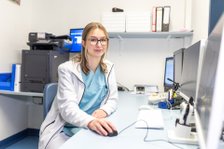Willkommen im MVZ Martha-Maria Gefäßzentrum Nürnberg!
In unserem MVZ Martha-Maria Gefäßzentrum behandeln wir Erkrankungen der Arterien, Venen und Lymphgefäße. Dazu gehören beispielsweise Verschlüsse und Verengungen der Schlagadern (Arterien), Erweiterungen der Gefäße (Aneurysmen) oder Krampfadern (Varizen). Ziel ist es, Beschwerden zu lindern, das Fortschreiten der Erkrankung aufzuhalten und die Lebensqualität zu verbessern.
Unser fachärztliches Team unter der Leitung von Dr. med. Andrea Lassen und unser Praxisteam sind gerne für Sie da.
Wir behandeln gesetzlich sowie privat versicherte Patientinnen und Patienten ambulant – wie in einer Arztpraxis. Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus Martha-Maria St. Theresien Nürnberg greifen wir zudem rasch auf ein großes Netzwerk an Spezialisten aus verschiedenen Fachbereichen zu. Dadurch bieten wir Ihnen über das übliche Praxis-Spektrum hinausgehende Leistungen an, wie z.B. die offene sowie die endovenöse Krampfaderoperation.
Unser Leistungsspektrum
Krampfadern (Varikose) +
Es handelt sich um eine Schwäche der oberflächlichen Venen (Stamm- und Seitenastvenen) mit defekten Venenklappen und einem daraus resultierenden Blutfluss zurück zum Bein.
Ohne eine Behandlung der Krampfadern können langfristig Komplikationen, wie eine Schädigung des tiefen Venensystems (chronische venöse Insuffizienz ) oder ein „offenes Bein“ ( Ulcus cruris ) entstehen.
Diagnostik:
• Ultraschall mit Farbduplex
• verschiedene Funktionsmessungen
Therapie:
Operativ
• endovenöse Verfahren (Radiofrequenzablation) in örtlicher Betäubung (Thumeszenzanästhesie)
• offene Krampfaderchirurgie (Strippingverfahren) ín Vollnarkose
• Entfernung von kleineren Krampfadern mit Minischnitten und Varaday-Häkchen in örtlicher Betäubung
Alle Verfahren werden angewendet und die passende Maßnahme individuell besprochen. Die Eingriffe können fast immer ambulant durchgeführt werden.
Konservativ
• Kompressionsstrumpfversorgung
Arterielle Verschlusskrankheit (z.B. Schaufensterkrankheit)
Was ist die periphere arterielle Verschlusskrankheit?
Die periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK) ist eine Erkrankung der Schlagadern der Extremitäten. Die Gefäße der Beine sind hierbei viel häufiger betroffen als die Gefäße der Arme. Durch Veränderungen der Gefäßwand mit Ablagerungen (sog. Arteriosklerose) kommt es zu Engstellen und schließlich zu Verschlüssen der Gefäße. Da diese Prozesse schleichend auftreten und der Körper Umgehungskreisläufe ausbildet, handelt es sich meist um eine Erkrankung des höheren Lebensalters, kann aber auch in jüngeren Jahren auftreten.
Risikofaktoren für die arterielle Verschlusskrankheit:
• Erhöhte Blutfette (insbesondere das LDL-Cholesterin)
• Bluthochdruck
• Diabetes mellitus
• Rauchen
Stadien der arteriellen Verschlusskrankheit
Stadium I: Eine Verminderung der Beindurchblutung ist nachgewiesen, es bestehen aber keine Beschwerden. Wichtig ist in diesem Stadium die Behandlung der Risikofaktoren, da diese Patienten oft auch eine koronare Herzkrankheit mit einem erhöhten Risiko für einen Herzinfarkt haben. Eine Behandlung der Engstellen oder Verschlüsse der Beinarterien ist bei fehlenden Beschwerden nicht angezeigt.
Stadium II: Es handelt sich hier um die sog. „Schaufensterkrankheit“. Nach anfänglich schmerzfreiem Gehen treten nach einer variablen Gehstrecke zunehmende krampfartige Schmerzen in den Beinen (meist in der Wade) auf. Die Patienten müssen stehenbleiben, bis sich der Schmerz wieder legt.
Auch hier hat die bestmögliche Behandlung der Risikofaktoren Priorität. Eine Verbesserung der Beindurchblutung ist nur angezeigt, wenn der Patient durch die Beschwerden in seinem Alltag eingeschränkt ist und einen eindeutigen Behandlungswunsch hat. Nutzen und Risiko der Behandlung müssen gegeneinander abgewogen werden. Oft ist eine minimal-invasive Behandlung mit Katheterverfahren in örtlicher Betäubung möglich. Bei bestimmten Verschlussmustern kann auch mit regelmäßigem Gehtraining eine Verbesserung der Gehstrecke erreicht werden.
Stadium III: In diesem Stadium kommt es zu Schmerzen im Fuß auch in Ruhe und besonders nachts und im Liegen. Es liegt eine kritische Durchblutungsstörung vor, die meist behandelt werden muss, um die Lebensqualität zu verbessern und ein Fortschreiten der Erkrankung zu verhindern.
Stadium IV: Durch die mangelnde Durchblutung kommt es entweder zum Untergang von Gewebe insbesondere am Fuß und Ausbildung von Wunden oder Wunden nach Verletzungen heilen nicht mehr ab. Auch eine Infektion der Wunde kann vom Körper nicht mehr beherrscht werden und schließlich zur Amputation führen.
Hier muss unverzüglich gehandelt werden, um eine weitere Gewebszerstörung und den Verlust des Fußes zu verhindern. Nach einer Gefäßultraschalluntersuchung erfolgt meist eine Gefäßdarstellung (Angiographie) mit Kontrastmittel, um die optimale Therapieentscheidung treffen zu können. In Frage kommen hier neben Katheterverfahren auch operative Verfahren zur Wiederherstellung der Durchblutung, z.B. mittels Bypass.
Therapie der arteriellen Verschlusskrankheit
Konservative Therapie:
• Strukturiertes Gehtraining
• Vermeidung und Behandlung der Risikofaktoren
Interventionelle Therapie (meist in örtlicher Betäubung):
• Aufdehnung mit einem Ballonkatheter (PTA)
• Implantation eines Stents
Operative Therapie (Narkose):
• „Säuberung“ des Gefäßes (Entfernung der Ablagerungen) und Verschluss der Arterie mittels Patchplastik
• Bypassverfahren zur Überbrückung längerer Verschlüsse. Als Bypassmaterial kommen körpereigene Venen oder Kunststoffprothesen in Frage.
Therapiemöglichkeiten wenn Katheterverfahren oder operative Verfahren zur Durchblutungsverbesserung ausgeschöpft oder nicht mehr möglich sind:
• Infusionstherapie: Bei kritischer Durchblutungsstörung der Beine setzen wir auch eine Infusionstherapie mit Prostaglandinen ein. Die Therapie wird entweder stationär oder bei geeigneten Patienten auch ambulant bei uns in der Praxis durchgeführt.
• CT-gesteuerte Verödung der Beckennerven (Sympathicus), was zu einer Erweiterung der Endarterienäste führt.
• Anlage eines sog. Neurostimulators mit Elektroden am Rückenmark zur Schmerzausschaltung
Halsschlagaderverengung (Carotisstenose)
Was ist eine Halsschlagaderverengung?
Die Halsschlagadern, auch Carotiden genannt, versorgen das Gehirn mit sauerstoffreichem Blut. Wenn eine Halsschlagader durch arteriosklerotische Ablagerungen (Plaque) verengt ist, spricht man von einer Carotis-Stenose. Je höher der Grad der Einengung, desto größer ist das Risiko für einen dadurch verursachten Schlaganfall, insbesondere wenn bereits flüchtige Schlaganfallsymptome aufgetreten sind (kurzzeitige Lähmungen oder Gefühlsstörungen auf einer Körperseite oder Sehstörungen auf einem Auge). Ursächlich hierfür ist meist keine Mangelversorgung des Gehirns, sondern das Ablösen von Teilen der Ablagerung, die dann mit dem Blutstrom ins Gehirn gelangen und dort kleinere Arterien verstopfen.
Diagnostik einer Halsschlagaderverengung
Die Diagnostik findet mittels einer Gefäßultraschall-Untersuchung (farbcodierte Duplexsonografie) direkt in unserer Praxis statt. Ist eine Carotisstenose bereits bekannt, sind regelmäßige Kontrolluntersuchungen der Halsschlagadern wichtig, da sich die Engstellen mit der Zeit verändern bzw. zunehmen können.
Therapie einer Halsschlagaderverengung
Konservative Therapie:
Bei allen Engstellen unabhängig von der Ausprägung sollten die Risikofaktoren (Blutdruck, Rauchen, Diabetes, erhöhte Blutfette) optimal behandelt bzw. das Rauchen beendet werden. Dies wird in der Wissenschaft als „Best Medical Treatment“ bezeichnet. Hierdurch bilden sich bereits bestehende Engstellen nicht zurück, sondern ein Fortschreiten der Erkrankung soll verhindert und damit das Risiko für einen Schlaganfall minimiert werden.
Operative Therapie:
Die Therapie der Wahl bei einer hochgradigen Carotisstenose ist die operative Entfernung der Ablagerung (der Plaque). In der Hand eines erfahrenen Gefäßchirurgen werden hiermit die besten Langzeitergebnisse erzielt. In ausgewählten Fällen kann auch die Implantation eines Stents in die Halsschlagader sinnvoll sein.
Beide Gefäßoperationen können in Narkose oder in örtlicher Betäubung erfolgen. Dabei arbeiten wir eng mit der Sektion Gefäßchirurgie am Klinikstandort St. Theresien zusammen. In der Regel beträgt der stationäre Aufenthalt nach Operation der Halsschlagader rund drei Tage.
Bauchschlagadererweiterung (Bauchaortenaneurysma)
Was macht die Bauchschlagader?
Durch die Hauptschlagader (Aorta) gelangt das sauerstoffreiche Blut aus dem Herzen in den Körper. Den Teil der Hauptschlagader, der in der Bauchhöhle verläuft, nennt man Bauchschlagader (Bauchaorta).
Was ist ein Bauchschlagaderaneurysma?
Wenn sich die Bauchschlagader an einer Stelle erweitert und eine Aussackung mit einem Durchmesser von mehr als drei Zentimeter bildet, spricht man von einem Aneurysma der Bauchschlagader (Bauchaortenaneurysma). Betroffen sind meist Männer über 65 Jahre und insbesondere Patienten, deren Eltern oder Geschwister bereits ein Aneurysma haben oder hatten.
Wer ein derartiges Aneurysma hat, merkt dies zunächst nicht. Aneurysmen bleiben meist harmlos, sofern sie nicht weiterwachsen. Werden sie aber größer, können sie platzen und zu einem inneren Verbluten führen. Um dies zu verhindern, sollten Bauchaortenaneurysmen ab einem Durchmesser von 5 bis 5,5 cm operativ behandelt werden.
Diagnostik eines Bauchschlagaderaneurysma
Die Diagnostik und die Verlaufskontrollen eines Bauchschlagaderaneurysmas erfolgen mit einer Ultraschalluntersuchung des Bauches. Für gute Untersuchungsbedingungen ist es wichtig, dass der Patient / die Patientin nüchtern zur Untersuchung erscheint. Deshalb findet die Untersuchung in der Regel vormittags statt.
Therapie eines Bauchschlagaderaneurysma
Das Ziel der Therapie ist es das Aneurysma auszuschalten und somit eine Ruptur zu verhindern. Hierfür gibt es verschiedene Therapiemöglichkeiten, deren Vor- und Nachteile wir mit Ihnen diskutieren und dann mit Ihnen individuell entscheiden:
Endovaskulärer Eingriff (EVAR): über die Leistenarterien wird eine beschichtete Stentprothese in die Bauchschlagader eingebracht und das Aneurysma so ausgeschaltet. Der stationäre Aufenthalt dauert in der Regel drei bis fünf Tage. Ein Eröffnen des Bauchraumes ist dabei nicht notwendig. Wichtig sind danach regelmäßige und lebenslange Kontrolluntersuchungen mittels CT oder Ultraschall.
Offene Operation: über einen Bauchschnitt wird das Aneurysma eröffnet und durch eine Gefäßprothese ersetzt. Der stationäre Aufenthalt beträgt im Durchschnitt 7 – 10 Tage. Spezielle Kontrolluntersuchungen sind im weiteren Verlauf außer einem gelegentlichen Ultraschall nicht notwendig.
Angeborene Gefäßfehlbildungen
Beinvenenthrombose / Venenentzündung (Thrombophlebitis)
Bei einer Beinvenenthrombose liegt der Verschluss einer tiefen Vene vor.
Dies führt zu einer Behinderung des Rückflusses vom Bein zum Herzen und dadurch bedingt zu einer Stauung/ Schwellung im betreffenden Bein.
Eine Venenentzündung geht mit dem Verschluss einer oberflächlichen Vene und einer Entzündungsreaktion derselben einher. Dies tritt gehäuft bei einem Krampfaderleiden als Komplikation auf.
Beide Erkrankungen sind akut und benötigen eine zeitnahe Therapie.
Diagnostik:
• Ultraschall mit Farbduplex
Therapie:
• Medikamentöse Hemmung der Blutgerinnung
• Kompression des Beines
• Gegebenenfalls entzündungshemmende Medikamente und lokal Heparin (bei Venenentzündungen)
• Abklärung der Ursache
Chronische Wunden und diabetischer Fuß
Lipödem und Lymphödem
Das Lipödem ist gekennzeichnet durch eine übermäßige, meist symetrische Fettgewebsansammlung an Beinen und Armen. Zum Teil ist das Gewebe druckschmerzhaft und neigt zu Blutergüssen. Es sind vorwiegend Frauen betroffen mit vermehrtem Auftreten in der Pubertät, Schwangerschaft und in den Wechseljahren. Nicht jedes Lipödem ist krankhaft. Fortgeschrittene Stadien können zusätzlich ein Lymphödem entwickeln. Übergewicht verschlechtert das Lipödem.
Bei einem Lymphödem liegt eine Störung der Funktion der Lymphbahnen und damit ein verschlechterter Abtransport der Lymphflüssigkeit aus dem Gewebe nach zentral vor. Dies führt zu einer meist schmerzlosen und asymmetrischen Schwellung einer Extremität. Ein Lymphödem kann angeboren oder erworben (z. B. nach Operationen) sein. Lokale Infektionen verschlechtern das Lymphödem.
Diagnostik
- Körperliche Untersuchung
- Sonographie mit Farbduplex
- Von den Krankenkassen zum Teil gefordert: Umfangsmessungen, gegebenenfalls Fotodokumentation
Therapie
Lipödem
- Normalgewicht anstreben und halten
- Bewegung
- Kompressionsversorgung meist mit Flachstrickgewebe
- gegebenenfalls manuelle/apparative Lymphdrainage bei fortgeschrittenen Stadien (operativ durch plastische Chirurgie: Liposuktion)
Lymphödem
- Kompression mit Flachstrickgewebe, gegebenenfalls auch mit höheren Kompressionsklassen
- manuelle Lymphdrainagen, gegebenenfalls in Dauertherapie
- Hautpflege
Individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL) für Selbstzahlende
Sogenannte „IGeL-Leistungen“, kurz für „Individuelle Gesundheitsleistungen“, sind ärztliche Angebote, die nicht zum Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen gehören und von Patienten selbst bezahlt werden.
Wir bieten folgende IGeL-Leistungen an:
• Besenreiserbehandlung
• Radiofrequenzablation (RFA)
• Risikoermittlung Reisethrombose
• Gefäß-Check-up
• Spezielle gerätegestützte Lymphdrainage
- Kontakt
- 0911 27061-0
- 0911 288696
- Montag 07:45 - 13:00 Uhr
13:30 - 17:00 Uhr - Dienstag 07:45 - 12:00 Uhr
12:30 - 16:00 Uhr - Mittwoch - Donnerstag 07:45 - 13:00 Uhr
13:30 - 16:00 Uhr - Freitag 07:45 - 13:30 Uhr
Gerne beantworten wir Ihre Fragen. Rufen Sie uns einfach zu den angegebenen Sprechzeiten an. Wir freuen uns auf Ihren Anruf und helfen Ihnen gerne weiter.
Ärztliche Leitung

Andrea Lassen
- Ärztliche Leitung
Fachärztin für Allgemeinchirurgie und Phlebologie
Lebenslauf Dr. med. Andrea Lassen
geb. 29.04.1967 in Nürnberg, verheiratet , 2 Kinder
- 1973 - ´86 Schulausbildung mit Abitur
- 1987 - ´93 Studium der Humanmedizin Friedrich - Alexander Universität Erlangen - Nürnberg
Im PJ: Gynäkologie und Geburtshilfe an der University of Minnesota, Minneapolis, USA - 1993 - ´95 Ärztin im Praktikum, Chirurgische Universitätsklinik Erlangen
- 1995 Promotion
- 1995 - 2000 Facharztausbildung Chirurgie, Klinikum Neumarkt i.d. Oberpfalz
- 2000 - ´05 Facharztausbildung Gefäßchirurgie, Theresienkrankenhaus Mannheim
- 2002 Zusatzbezeichung Sportmedizin
- 2005 Zusatzbezeichung Phlebologie
- 2006 - ´07 Praxis PD Dr A. Hoffmann, Gefäßchirurgie / Phlebologie, Nürnberg
- 2007 - ´09 Praxis A. Ananin, Chirurgie / Phlebologie, Nürnberg
- 2009 Chirurgie Stadtkrankenhaus Schwabach
- 2010 - ´22 Praxis A. Ananin, Chirurgie / Phlebologie, Nürnberg
- seit 11´22 MVZ Martha-Maria Gefäßzentrum Nürnberg
8´23 : geteilte ärztliche Leitung
8´24 : ärzliche Leitung
9´24 : Fortbildung hygienebeauftragte Ärztin
Weitere Angaben :
- Mitglied im BDC
- Mitglied in der deutschen Gesellschaft für Phlebologie und Lymphologie
- seit 1998 sportmedizinische Betreuung der Jugend- und Herrenbundesliga- Mannschaft des Nürnberger Hockey und Tennis Clubs
Lebenslauf Dr. med. Axel Stübinger
- 1998 – 1995 Studium der Humanmedizin an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen
- 1996 Promotion am Institut für Humangenetik der Universität Erlangen
- 1995 – 2003 Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinchirurgie und Gefäßchirurgie, Klinikum Nürnberg Süd (Prof. Raithel)
- 2005 – 2014 Leitender Oberarzt der Gefäßchirurgischen Abteilung, Universitätsklinik Erlangen (Prof. Lang)
- 2008 Erwerb der Zusatzbezeichnung Phlebologie
- 2014 – 2022 Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie, endovaskuläre Chirurgie und Phlebologie am Klinikum Ansbach
- Seit 7/2022 Leiter der Sektion Gefäßchirurgie am Standort St. Theresien
- 2023 – 2025 berufsbegleitendes Zertifikatsstudium zum Mediator und Coach (univ.)
Zusatzqualifikationen
- Zertifizierung als endovaskulärer Chirurg DGG
- Leitung von OP-Kursen Carotis und Aorta im Rahmen der Sommerakademie der DGG
- Autor für Patientenaufklärungsbögen im Fachgebiet Gefäßchirurgie
- Kontrastmittelsonographie
Mitgliedschaften
- Deutsche Gesellschaft für Gefäßchirurgie (DGG)
Aktives Mitglied in der Sektion gefäßchirurgische Techniken - Deutsche Gesellschaft für Phlebologie
- European Society for Vascular Surgery
- Berufsverband deutscher Chirurgen
Ärzte und Medizinische Fachangestellte (MFA)

- PD Dr. med.
Beatrix Cucuruz - Chefärztin Klinik für Gefäß- und endovaskuläre Chirurgie Krankenhaus Martha-Maria Nürnberg
Fachärztin für Gefäßchirurgie
- Mehr anzeigen

- Dr. med.
Axel Stübinger - Leiter Sektion Gefäßchirurgie am Standort St. Theresien
Facharzt für Chirurgie und Gefäßchirurgie
- Mehr anzeigen

- Doctor medic
Robert Finichi - Oberarzt
Facharzt für Gefäßchirurgie
- Mehr anzeigen

- Dr. med.
Julian Tank - Funktionsoberarzt
Facharzt für Viszeralchirurgie
- Mehr anzeigen

- Olga Kulinskaya
- Mehr anzeigen
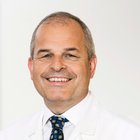
- Gerhard Hauser
- Facharzt für Innere Medizin
- Mehr anzeigen

- Tanja Otto
- Praxismanagerin
- Mehr anzeigen

- Carmen Müller
- Stellvertretende Praxismanagerin
- Mehr anzeigen
Ihre Anfahrt zu uns
Sie erreichen unser Gefäßzentrum in Nürnberg bequem:
- Öffentliche Verkehrsmittel: Bus-Haltestelle "Theresienkrankenhaus" und U-Bahn-Haltestelle "Nordostbahnhof"
- Parkmöglichkeiten: Parkplatz vor dem Theresienkrankenhaus
Hinweis: Am Haupteingang ist auch ein behindertengerechter Zugang mit Aufzug vorhanden.
MVZ Martha-Maria Gefäßzentrum Nürnberg
Mommsenstraße 22
90491 Nürnberg
Tel.: 0911 27061-0
Was sind MVZ?
Medizinische Versorgungszentren (MVZ) sind eine Form der ambulanten Versorgung mit fachübergreifenden, ärztlich geleiteten Einrichtungen, die über die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Facharzt- oder Schwerpunktbezeichnungen eine interdisziplinäre ambulante Versorgung aus einer Hand gewährleisten.
Ihr Karrierestart
bei Martha-Maria
Ob Berufsstart mit einer Ausbildung, als Einsteiger oder Umsteiger, bei Martha-Maria finden Sie Ihre Berufung. Ob in Pflege- und Medizinberufen, in kaufmännischen Bereichen oder von der Haustechnik, im Kantinenbereich bis hin zur Reinigungstechnik bieten wir ein breites Spektrum beruflicher Möglichkeiten.
Offene Stellenangebote
Werte und Leitbild
Martha-Maria ist ein selbstständiges Diakoniewerk in der Evangelisch-methodistischen Kirche, die zur Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen gehört, und Mitglied im Diakonischen Werk. Zu Martha-Maria gehören Krankenhäuser, Berufsfachschulen für Pflege, Seniorenzentren und Erholungseinrichtungen mit insgesamt mehr als 4.700 Mitarbeitenden in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt.